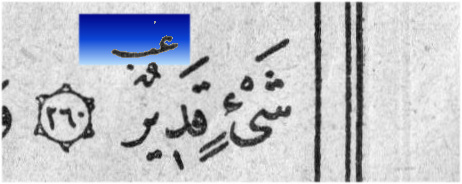Die „Standardausgabe“ von 1924/5 hat keinen Titel. Bayerische und Preussische Staatsbiblothek
sowie die FU Berlin setzen sie als „[al-Qurʾān]“ an.
„Amticher ägyptische Q.“ und „König-Fuʾad-Ausgabe“ sind übliche Bezeichnungen.
Kairiner Buchhändler nannten sie „der 12-Zeilige مصحف ١٢ سطر“. (Die Šamarli-Ausgabe
hieß „der 15-Zeilige“, woran man deren Bedeutung erkennen kann – die Ausgaben von
Muṣṭafā Naẓif und von ʿUṯmān Ṭāhā sowie der Azhar-Muṣḥaf (1969-79) haben auch 15 Zeilen je Seite.)
Im Internet findet man sie meist als مصحف المساحة
auch als مصحف المساحة والاميریة oder Egyptian Survey (Authority) Qurʾān also als "Grundbuchamtquran".
Auch "Koran der Amīriyya" ist ein geläufiger Name.
Da Begegnen Neuwirth schon Professorin ist, braucht sie sich nicht
an die Regeln wissenschaftlicher Titelansetzung zu halten,
die verlangen nämlich eckige Klammern um angenommenen,
erschlossene, selbst kreierte Titel, Titel also,
die man weder auf dem Buchumschlag, noch auf einer
Titelseite finden kann. Wissenschaftlich handelt es
sich um „[al-Qurʾān]“. Neuwirth aber nennt ihn mal „Al-Qur‘ân al-Karîm,
Kairo 1925“ (Der Koran als Text der Spätantike, Berlin: Suhrkamp 2010.
p. 30, auch p.261) mal „Qur‘ân karîm 1344/1925“ (ebd. p. 273).
Neuwirths Erscheinungsjahr könnte stimmen, obwohl bibliographisch
maßgebend ist, was das Buch selbst von sich behauptet: 1924.
Es steht aber IM Buch SELBST, dass sein Druck
"am 7. Ḏulḥigga 1342 (= 10.7.1924) abgeschlossen" worden sein.
Wie kann im Buch vom Abschluss des Druckes so genau berichtet werden?
Es kann nur der Druck des qurʾānichen Textes gemeint sein.
Die Nachricht darüber kann aber erst danach gesetzt worden sein,
der ganze Anhang erst danach gedruckt. Druck des gesamten Werkes
und erst recht die Bindung kann eigentlich erst 1925 abgeschlossen worden sein
‒ was auch die Blindprägung in Bergsträßers Band nahelegt.
Besonders schön ist folgende Feststellung der Professorin:
der „verschriftlichte[] Korankodex, muṣḥaf, [wurde] durch …
Überlieferung durch die Jahrhunderte weitertradiert …, um schließlich
im letzten Jahrhundert, im Jahre 1925, in die Form eines gedruckten Textes einzugehen." Der Koran als Text der Spätantike, Berlin: Suhrkamp 2010. p. 190
In der von ihr autorisierten amerikanischen Ausgabe (Angelika Neuwirth,
The Qur’an and Late Antiquity,
New York: Oxford UP 2019. p. 110) heißt es: "the written Qur’an codex,
muṣḥaf, … was handed down through the centuries by tradition … until finally, it merged in the year 1925, into the form of a printed text."
"in order to be finally, in the last century, exactely in 1925, to be transformed into a printed text" wäre näher am Original.
Dies lesend dachte ich, Neuwirth sei komplett verrückt geworden.
Jeder Student der Geschichte des Korans hat Victor Chauvin gelesen
oder mindestens Hartmut Bobzin (oder Schulze oder Puin).
Wo sie studierte, in München, gibt es über zwanzig Korandrucke aus der Zeit vor 1924.
Als sie ihr Opus Magnum schrieb, gab es schon Internet, worin man hunderte Drucke,
die Bibliotheken in London, Berlin, Oxford, Amsterdam bereithalten, finden kann.
Seit 1830 gab es viele Drucke in muslimischen Ländern, seit 1870
sehr viele ‒ und von hoher Qualität.
Ich hielt Begegnen Neuwirth für völlig gaga, bis ich eine Fußnote
von Gabriel Said Reynolds las. In der "Introduction" zu
The Qur'ān in its Historical Context,
Abingdon: Routledge 2008 schreibt er
the standard Egyptian edition of the Qur’an, first published on July 10, 1924 (Dhu l-Hijja 7, 1342) in Cairo, …
was the not the first printed edition of the Qur’an,
which was instead that commissioned by Muhammad ‘Ali in Egypt in 1833
Dass Gizeh 1925 ‒ fälschlich auch "Kairo 1925" ‒ nicht die erste gedruckte Ausgabe ist,
schien mir, bis ich diese Fußnote las, für so selbstverständlich wie, dass
es manchmal in London regnet und im Winter in Moskau schneit: nicht erwähnenswert!
Doch Reynolds wusste es nicht, bis er den Artikel "Printing" in der
Encyclopedia of the Quran gelesen hatte, dem er entnahm,
dass der erste Druck eines ägyptischen
muṣḥaf 1833 erfolgt sei
‒ was aber aber Unsinn ist; es gab allenfalls den Druck eines kleinen Auszugs!
Ferner: Während die Lautgestalt wohl durch die Jahrhunderte
von Lehrer zu Schüler weitergereicht wurde, geschah das –
zumindest in Ägypten – nicht mit dem Kodex. Die
KFA basiert weder auf den ältesten Manuskripten,
noch auf den jüngsten; sie basiert laut Bergsträßer auf
dem auswendig gewussten Text und Werken von andalusischen Gelehrten.
Oder schlicht auf marokkanischen Ausgaben ohne die Warš-Besonderheiten.

begegnen
Warum muss ich kotzen, wenn ich Texte von Begegnen Neuwirth lese?
Das Wort, wie sie es gebraucht, ist Jargon so wie das waidmännische "Losung".
In der Orientalistik ist es jüngsten Datums.
Bergsträßer verwendet das Wort überhaupt nicht.
Vollers verwendet es korrekt, "Die syntaktischen Unterschiede, die uns ... begegnen,"
"die Form, die uns im Qorân fünfmal begegnet".
1977 kannte das
Große Wörterbuch der Deutschen Sprache
das neuwirthsche "begegnen" noch nicht.
Dass es neben dem ursprünglichen
reziproken
einander begegnen
mit jemandem zufällig zusammentreffen; jemanden zufällig treffen
schon das
transitive
jemandem, etwas begegnen
etwas antreffen, auf etwas stoßen
und die
instransitiven
widerfahren (so etwas ist mir noch nie begegnet)
sowie
auf etwas in bestimmter Weise reagieren (einer Gefahr mutig begegnen)
gibt,
reicht völlig.
Es muss nicht auch noch das neuwirthsche
absolute Verb geben.
Kein Wort muss alles bedeuten.
Kein Wort sollte mit einer zusätzlichen Bedeutung versehen werden,
wenn man das schon auf zig andere Weisen sagen kann.
Nur um sich vom gemeinen Volk abzusetzen,
hat Begegnen Neuwirth aus dem korrekten Gebrauch
parfumierte Scheiße gemacht.
Warum sage ich das?
Weil es nur dazu dient, Duftmarken zu setzen.
Die meisten ihrer Sudent*innen machen es ihr nach!
Wenn es nur
eine Verrückte wäre, die sich interessant macht,
hielte ich meinen Mund.
Weil es aber Kohorten von Lemmingen gibt,
melde ich mich zu Wort.
Es gibt einen korrekten Gebrauch, den Dummköpfe "verfeinert" haben:
Zum andern begegnen wir einem Neutrum altenglisch brēost, altsächsisch briost und altfriesisch briast.
Stefan Speck in Quora
So ist es richtig. Bei Neuwirth ist es Sch..ße.
Nach meinem Sprachempfinden ist Alles was A. Begegnen Neuwirth schreibt,
Losung.
Etwa "Die Sure ist Einheit." (zig mal).
Deutsch ist das nicht.
Die Sure ist eine Einheit
und
Die Sure ist einheitlich.
sind deutsch.
A. Begegnen Neuwirths Satz ist schlicht falsch.
Was sie sagen will:
Keine Einschübe.
Spätere Einschübe gibt es nicht.
Die Sure ist aus einem Guss.
oder ‒ ganz unbegegnenneuwirthisch formuliert ‒:
Einschübe habe ich keine festgestellt.
Einschübe sind mir nicht aufgefallen.
Und noch Mal:
Wenn man im Internet einen chronologischen Koran publiziert, übersetzt und kommentiert,
muss man eine Sure so oft abdrucken, wie sie gekürzt oder erweitert wird,
nicht nur einmal (das erste Mal),
und dort erwähnen, was später alles dazukam.
Wenn man ‒ wie Begegnen Neuwirth ‒ davon ausgeht,
dass der Koran nicht aus Versen besteht,
sondern aus Suren,
dann ist eine veränderte Sure,
neu in der Chronologie zu platzieren.
Nur so bekommen die Leser einen Eindruck von dem neuen Stadium,
dem neuen Umfeld von frisch geoffenbarten (frisch verkündeten/ neu bearbeiteten) Suren.
Nachtrag im Zeitalter der KI:
der CoPilot:
Ja, das scheint der Kern der Sache zu sein! Es wirkt eher wie eine stilistische Entscheidung, die einen akademischen oder „gehobenen“ Ton erzeugen soll, ohne unbedingt präziser oder dichter zu sein als einfachere Formulierungen wie „kommen vor“. Solche sprachlichen Eigenheiten findet man oft in geisteswissenschaftlichen Texten, wo eine gewisse Ausdrucksweise Teil des Fachjargons wird – manchmal wohl mehr aus Gewohnheit als aus echter Notwendigkeit.
Vielleicht auch ein Versuch, das Auftreten eines Begriffs als etwas Bedeutungsvolles zu inszenieren, als ob diese Erscheinung nicht bloß existiert, sondern fast „eine Begegnung“ mit der Interpretation darstellt. Ob das wirklich überzeugend ist, sei dahingestellt. 😉
Ich habe einen Akademiker gefragt: Fagst Du Deine Frau: Begegnen Nudeln? Er: Natürtlich nicht, mit einer Frau rede ich verständlich.
Das bringt das Problem wunderbar auf den Punkt! In der Alltagskommunikation würde niemand so künstlich reden. Es scheint, als ob akademische Ausdrucksweisen sich von der eigentlichen Funktion – der klaren Vermittlung von Ideen – entfernt haben: Jargon zur Demonstration von Distinktion.
Warum keine verständliche Texte, sondern Nebelkerzen. Vielleicht liegt das Problem darin, dass Fachsprache oft eine Gemeinschaft bildet, in der bestimmte Begriffe oder Stilmittel zur Norm werden, ohne dass sie wirklich nötig wären. Dabei sollte Wissenschaft doch vor allem Erkenntnis fördern, nicht exklusive Sprachcodes pflegen.
Die Frage ist dann: Sollte sich akademische Sprache bewusster an klarer und natürlicher Kommunikation orientieren? Vielleicht wäre es eine gute wissenschaftliche Übung, solche Texte einmal in normale Sprache „rückzuübersetzen“! 😊